|
Überlegungen
zur Rekonstruktion
der Dollnsteiner Oberburg
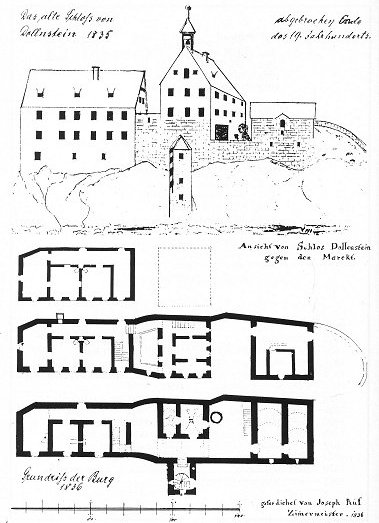 |
Die zuverlässige
Abbildung der Oberburg, gezeichnet wohl erst nach
ihrem Abbruch zwischen 1835 und 1850 vom Dollnsteiner Zimmermeister Joseph Ruf, zeigt die
Burganlage von Südosten.
Der
Abbildung sind vor allem auch sehr
detaillierte Grundrisse beigefügt, mitsamt einer
Maßstabsleiste (wohl in bayr. Fuß zu 29,19 cm). Zwar
ist kaum davon auszugehen, dass diesen Plänen
Vermessungen zugrunde liegen, sondern es dürfte sich
durchwegs um Schätzmaße handeln, doch dürften die
Schätzungen eines Zimmermeisters immerhin eine
gewisse Güte besitzen.
Diese Pläne reizen
dazu, sie in Kartenwerke zu implementieren, um die
Vorstellungen zum Aussehen der Burg zu
konkretisieren.
Als Grundlage zu einem
Rekonstruktionsversuch dienen moderne Planmaterialien
einerseits und die Uraufnahme des Ortsbereiches von 1813
(Maßstab 1:2500), die immerhin noch Reste der Oberburg
andeutet und somit trotz gewisser Maßungenauigkeiten eine
wichtige Quelle darstellt. Der bedeutendste Unterschied
liegt darin, dass sich im aktuellen Plan durch die
eingezeichneten Garagen, die beinahe bis an den Fels
heranreichen, die reale Breite des Felsens ermitteln lässt,
der auf dem Uraufnahmeblatt von 1813 im mittlerem Bereich zu
schmal erscheint.
Links:
Die Zeichnung von Joseph Ruf 1835 - Auf riss
und Grundriss
Maßstabsleiste in Bayer. Fuß (29,186 cm) |
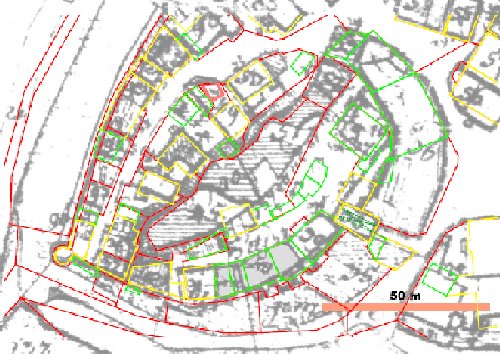
Uraufnahme des
Ortsbereiches von 1813 (schwarz)
und heutiger Baubestand (bunt)
Urheberrecht: Gerald Neuber |
Beim
Übertragen des Ruf’schen Grundrisses fällt
zuallererst auf, dass der Gebäudekomplex der
Oberburg einschließlich des nördlichen Höfleins nur
rund 60 Meter misst, während der Schlossfelsen 80
Meter lang ist. Offenbar war nur ein Teil des
Felsens bebaut. Natürlich könnte sich Ruf auch in
den Maßen verschätzt haben. Eine entsprechende
Vergrößerung seines Planes um 33% (80:60) würde aber
jede Einpassung unmöglich machen; das nördliche
Gebäude würde dann 15 m breit sein und definitiv
nicht mehr auf den im Norden recht schmalen Felsen
passen. Dass er sich bei den Längen mehr verschätzt
hat als in den Breiten ist zwar theoretisch möglich,
aber doch mehr als spekulativ.
Es wird daher im
Folgenden weiter mit seinen Maßen gearbeitet – das
beste das wir eben bisher haben. Durch den
ausgesprochenen Längenunterschied bleibt natürlich
ein großer Spielraum, wo die Gebäude standen – mehr
im Norden oder mehr im Süden. |
Insgesamt
überzeugt dabei die südliche Variante mehr:
|
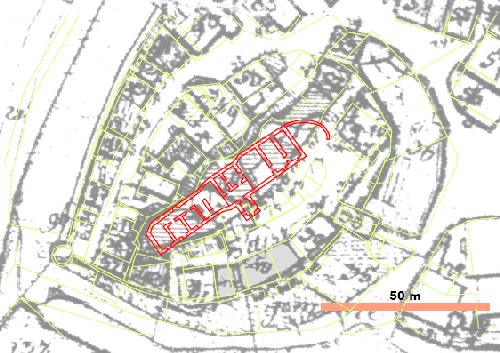
Lage der Oberburg nach der "südlichen Variante"
(rot) |
1. Der
Treppenturm kommt etwa im Bereich eines modernen an
den Felsen angebauten Wohnhauses zu liegen, also
noch im Burghof, wohingegen bei der nördlichen
Variante der Treppenturm quasi noch auf dem Felsen
läge. Möchte man das mittlere Gebäude hinreichend
weit nach Südosten verschieben, damit der Turm
richtig läge, wäre man gezwungen den gesamten
Gebäudekomplex aufzulösen, und die Bauteile
gegeneinander zu verdrehen. Auch wenn diese Variante
durchaus legitim ist, besteht doch ein methodisches
Gegenargument darin, dass man sich quasi frei
aussucht, welche Aspekte des Planes von Ruf man
übernimmt und welche nicht, ohne weitere Indizien in
der Hand zu haben.
2. Die Gebäude passen relativ gut auf den Felsen, während bei der
nördlichen Variante der Felsen im Norden fast schon
zu schmal für das darauf platzierte Gebäude ist. Nur
die Mauer im Norden reicht etwas zu weit in den
Burghof. Bei diesem kleinen Detail müsste also eine
Korrektur erfolgen. |
3. Es
ergeben sich relativ gute Übereinstimmungen mit den
Gebäuderesten, die im Plan von 1813 eingetragen sind. Die
Nordkante des Mittelbaus liegt ziemlich genau auf einer
eingetragenen Flurgrenze – und was liegt näher, als dass
diese nach der Versteigerung an den Gebäude(reste)n
angepasst worden war. Auch der Nordbau liegt mit einer Seite
auf einer relativ geraden Gebäudelinie von 1813.
4. Am
Südende des Felsens existieren die einzigen noch vorhanden
Mauerreste, so dass es plausibel ist, dass dort auch Gebäude
standen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass die Oberburg
auch mehrere Bauphasen aufgewiesen haben mag, im Prinzip
können die Mauern zu einem Gebäudeteil gehört haben, der zu
Rufs Lebzeiten nicht mehr existierte.
Es gibt
demnach also zumindest eine plausible Lösung für die Lage
der Oberburg. Doch es wäre sehr wichtig, hier weitere
Untersuchungen anzustellen. Ein 3D-Modell des Schlossfelsens
(nicht zuletzt mit den Mauerresten!) dürfte eine genauere
Prüfung erlauben. Idealerweise finden sich bei genauer
Untersuchung des Felsens noch ein paar wenige Indizien und
Bauspuren. Nicht zuletzt würde das Aufspüren des verfüllten
Brunnen (bei Ruf als Kreis eingetragen) einen wichtigen
Fixpunkt für die Lokalisierung der Gebäude liefern.
Mit solchen
Hinweisen ließe sich auch sonst die Genauigkeit von Rufs
Plan überprüfen. Bisher kann man dazu nur wenige
Überlegungen anstellen. Für ihn sprechen seine Profession
als Zimmermeister, der Detailreichtum seiner Pläne, die oben
nachgewiesene Möglichkeit den Plan in aktuelles
Kartenmaterial zu implementieren und einige kleine
Beobachtungen:
So
finden sich im Erdgeschoss offenbar kaum Fenster an
der Westseite, was damit korrespondiert, dass der
Schlossfelsen von Osten nach Westen ansteigt. Die
Rückwand des EG hat wohl der Fels selbst gebildet.
Entsprechend „niedrig“ liegt die Oberburg auch in
seiner Ansicht, nur rund 9 bis 11 Meter über dem
Niveau der Unterburg, während der Fels an der
Westseite, insbesondere im – unbebauten – Norden
einige Meter mehr Höhe erreicht.
Hinzu kommt ein kleines, weiteres, zugegebenermaßen
sehr unsicheres Detail: Im Norden des Felsens wäre
Platz für ein weiteres Gebäude, nämlich dem auf dem
Heidecker Fresko dargestellten Bergfried. Rischert
(ordentliche Quellenangabe) deutet den Nordbau von
Rufs Plan als Stumpf eines Bergfriedes. Das kann
auch durchaus sein, allerdings wären die Mauern für
ein solches Gebäude ungewöhnlich „dünn“ – nur etwas
über einen Meter, und die Einwölbung des
Erdgeschosses mit zwei parallel verlaufenden
Tonnengewölben wäre typologisch ungewöhnlich. Gerade
hier wird nun aber auch deutlich, wie wichtig
weitere klärende Untersuchungen wären.
|
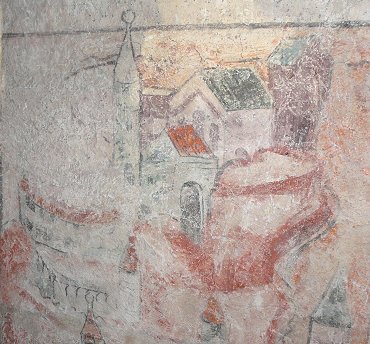
|
Insgesamt wird das
Heidecker Fresko aber erst verständlich, wenn man
die Zeichnung von Ruf und die heute noch bestehende
Unterburg im Blick hat. Das Fresko in der
Liebfrauenkapelle zu Heideck zeigt im Rahmen einer
St-Georgs-Darstellung eine Reihe von Burgen, von
denen man seit langem annimmt, dass es sich um
damalige Besitzungen der Herren von Heideck handelt.
Allerdings gelingt nur bei wenigen eine sichere
Identifikation. Dass die Burg in der linken oberen
Ecke aber die Dollnsteiner Anlage zeigt, darf als
sicher gelten. Auch wenn das Fresko keineswegs um
eine realistische Darstellung bemüht ist, sind doch
– wie bereits Rischert erkannt hat – alle
wesentlichen typologischen Merkmale deutlich
herausgearbeitet:
1. Die Burg liegt teilweise auf, teilweise vor einem
Felsen. Die Ringmauer links im Bild gibt dabei genau
richtig die halbkreisförmige Burgmauer der
Dollnsteiner Unterburg wieder.
2. Der linke der beiden dargestellten Türme steht
offenbar innerhalb des unteren Burghofes – er kann
also leicht als der Treppenturm zur Oberburg
verstanden werden.
Bild links:
Fresko in der Frauenkirche in Heideck 1418 |
Abweichungen zur Realität sollen nicht verschwiegen werden,
so wird das Burgtor direkt neben den Felsen dargestellt,
obwohl es in Wirklichkeit etwa in der Mitte der Burgmauer
liegt, allerdings reichen niedrigere Ausläufer des Felsens
näher an das Tor heran, als man auf den ersten Blick
vermuten würde, diese sind aber nur mehr im Inneren des an
die nördliche Ringmauer angebauten Stadels erkennbar.
Das Gebäude auf dem Felsen mit seinen drei großen Fenstern
an der Giebelseite und den überbetonten Ortgängen findet
sich völlig identisch auch bei anderen Burgen des Freskos,
es darf keinesfalls als reales Abbild missverstanden werden.
Insgesamt ist das 600 Jahre alte Bild jedenfalls zuverlässig
genug, um auch die Existenz des auf späteren Abbildungen
fehlenden Bergfrieds glaubhaft zu machen.
Dieser findet sich sonst nur mehr auf dem Marktwappen, das
allerdings noch abstrakter ist als das Heidecker Fresko. So
sind hier die Gebäude auf dem Felsen von einer
zinnengekrönten Mauer umgeben, die sonst nirgends bezeugt
ist und angesichts des sehr schmalen Felsens auch wenig
glaubhaft wirkt. Es dürfte sicher nur Verbindungsmauern
zwischen den einzelnen Gebäuden gegeben haben, wie sie auch
Ruf darstellt.
Text und Grafiken: Gerald Neuber
Alle Rechte vorbehalten
Quellen: Rischert, Helmut: Burg, Herrschaft und
Amt Dollnstein, 1987
Hensch, Mathias: Veröffentlichungen zu den Ausgrabungen in
der Burg Dollnstein
|